Es ist halb sieben Uhr abends. Alle sind müde, das Bad ist warm, die Schlafanzüge liegen bereit. „Jetzt geht’s ins Bett!“ sage ich, im Tonfall eines Polizisten, der das dritte Strafzettel-Duell für heute verloren hat. Mein Kind hingegen blickt mich an, lächelt schelmisch und rennt in Unterhose quer durch die Wohnung.
Ich spüre, wie sich in mir der Gedanke breitmacht: Aha, heute wird wieder getestet, wer hier das Sagen hat.
Dieses Gefühl kennen wohl viele Eltern.
Und doch lohnt es sich, kurz innezuhalten.
Was, wenn unsere Interpretation uns auf eine falsche Fährte führt?
Was, wenn hinter dem gefürchteten „Testen“ etwas ganz anderes steckt und zwar etwas,
das uns näher zusammenbringen soll?
Wenn Erwachsene sagen: „Das Kind testet mich, es will sehen, wie weit es gehen kann“, dann klingt das nach Berechnung, Strategie und Machtspiel.
Doch diese Sicht stimmt entwicklungspsychologisch nicht, zumindest nicht im Kleinkindalter.
Kinder zwischen 0 und etwa 3 Jahren können noch nicht strategisch kalkulieren oder Situationen bewusst herbeiführen, um Macht über Erwachsene zu erlangen. Der präfrontale Kortex, zuständig für Planung, Manipulation und taktisches Verhalten, ist in diesem Alter noch nicht reif genug.
Kleine Kinder handeln impulsiv, emotional und beziehungsorientiert,
nicht kalkulierend. Sie wollen erleben, wie sicher und verlässlich ihre Welt ist, und sie lernen durch Erfahrung und Resonanz.
Sie tun zum Beispiel etwas „Verbotenes“ oder überschreiten Grenzen, weil sie neugierig sind. Sie wollen wissen, wie etwas funktioniert oder wie du reagierst.
Kinder suchen Sicherheit.
Ein Kind, das „Grenzen testet“, überprüft unbewusst: Bleibst du da? Liebst du mich auch, wenn ich mich schwierig verhalte?
Aus neuropsychologischer Sicht
Der präfrontale Kortex, der logisches Denken, Impulskontrolle und Perspektivübernahme ermöglicht, reift erst zwischen dem 3. und 6. Lebensjahr so weit, dass Kinder beginnen, Handlungen gezielter zu planen und Folgen abzuschätzen. Davor sind Verhalten und Emotionen eng miteinander verknüpft.
Kinder reagieren, sie kalkulieren nicht.
Wenn Erwachsene darauf mit Strenge, Ignorieren oder Inkonsequenz reagieren, erlebt das Kind keine Sicherheit. Es spürt, dass sein emotionales Navigationssystem (Bindung → Orientierung) nicht funktioniert.
Dann beginnt es unbewusst verstärkt zu „testen“, um Klarheit zu gewinnen.
Bleibt die Reaktion unverständlich, verliert es Vertrauen in die Vorhersagbarkeit der Welt.
Ich schreie nicht, um dich auszutricksen. Ich schreie, weil du mein Leben bist
Im ersten Lebensjahr ist der Bindungsimpuls sogar existentiell.
Ein Säugling denkt nicht: „Ich teste mal, ob Mama reagiert.“
Er spürt: „Ich brauche jemanden, sonst bin ich in Gefahr.“
Er schreit, weil er evolutionär darauf programmiert ist, Kontakt und Versorgung sicherzustellen. Bleibt eine Reaktion aus, kann der Säugling tatsächlich in eine Art Panikzustand geraten. Das Nervensystem erlebt Lebensgefahr. Schreien ist also kein Testen, sondern ein Bindungssignal, das aus einem tiefen Instinkt heraus entsteht: „Hey, ich bin hier! Kümmere dich um mich. Ich brauche dich zum Überleben.“
Erwachsene denken oft: „Warum schreist du schon wieder? Ich habe gerade alles getan: Windel, Essen, Nähe. Du provozierst mich doch!“
Doch auf der inneren Bühne des Säuglings klingt es ganz anders: „Ich kann nicht laufen, nicht sprechen, nicht überleben ohne dich. Wenn ich rufe, dann prüfe ich nicht deine Nerven, sondern ob du da bist. Ob ich sicher bin. Ob die Welt hält.“
In diesem Alter geht es nicht um Macht und schon gar nicht um Manipulation.
Ein Baby erinnert: „Bleib bei mir. Ich brauche dich.“. Es testet nicht.
Ich werde ich, entdecken die 1-3-Jährigen. Und dafür brauche ich dich.
Ab etwa einem Jahr wird das Bindungsverhalten differenzierter.
Die Frage lautet nicht mehr nur: „Bist du da?“, sondern zunehmend auch:
„Kann ich selbst werden und trotzdem sicher bleiben?“
Mit dem Laufen und Sprechen wächst ein neues inneres Feuer:
Die Autonomie.
Und Eltern hören sich plötzlich denken:
„Jetzt beginnt der Machtkampf. Du willst deinen Kopf durchsetzen, koste es, was es wolle.“
Doch für das Kleinkind fühlt es sich so an:
„Ich entdecke mich, die Welt und meine Wirkung. Ich muss wissen: Was ist erlaubt? Was ist gefährlich? Bleibst du bei mir, wenn ich eigene Ideen habe? Werde ich gesehen, auch wenn ich gerade laut bin oder etwas will?“
Das „Testen“ ist hier kein bewusstes strategisches Schachspiel, sondern ein sozialer Kompass.
Kinder spüren, erleben, reagieren, wiederholen, bis sie Sicherheit finden.
Wir sind dabei die Leitplanke, nicht die Gegner.
Wenn Kleinkinder scheinbar Grenzen „testen“, geht es innerlich um
Selbstwirksamkeit „Ich will selbständig werden. Ich will ausprobieren, was ich kann.“
Sicherheit in der Bindung „Bleibst du bei mir, auch wenn ich schwierig bin?“
Vorhersagbarkeit „Bist du berechenbar und verlässlich?“
Kinder fragen durch ihr Verhalten
„Bist du meine sichere Basis?“
„Bist du echt oder spielst du etwas?“
„Kann ich dir vertrauen?“
„Kann ich Grenzen erforschen, ohne dich zu verlieren?“
„Hältst du mich aus, auch mit meinen Gefühlen?“
Diese Fragen werden nicht mit Sprache gestellt, sondern mit Verhalten.
Kinder brauchen in entwicklungskritischen Momenten keinen „perfekten“ Erwachsenen
Sie brauchen
Verlässlichkeit durch nachvollziehbare und stabile Reaktionen.
Authentizität, keine Show, keine künstliche Geduld.
Emotionale Verfügbarkeit „Ich bin bei dir, auch wenn es anstrengend ist“
Klarheit und Grenzen als Orientierung, nicht als Machtinstrument
Warum testen Kinder mehr, wenn Eltern unsicher werden?
Wenn Erwachsene innerlich schwanken, sich verstellen, gereizt, aber „freundlich tun“, oder inkonsequent handeln, dann wirkt die Welt für das Kind unvorhersehbar.
Und je unsicherer die Welt wirkt, desto stärker „testet“ das Kind, um Klarheit und Sicherheit zurückzubekommen.
Kinder testen uns nicht, um Macht zu bekommen.
Sie „testen“, um Sicherheit in der Beziehung und Orientierung in der Welt zu finden.
Und dafür reicht kein perfekter Erwachsener, sondern ein echter.
Drei Beispiele:
Wenn das Kind Essen vom Tisch wirft, dann sieht das für Erwachsene nach „Provozieren“ aus.
Tatsächlich erforscht das Kind Ursache und Wirkung („Wenn ich das tue, passiert etwas“), beobachtet deine Reaktion und lernt gleichzeitig:
„Bleibt Mama/Papa ruhig? Ist es gefährlich oder nur ein Geräusch? Wie reagiert sie/er?“
Wenn du gelassen, aber klar bleibst („Das Essen gehört auf den Teller, ich helfe dir“), lernt das Kind: Grenzen sind verlässlich und liebevoll zugleich.
Wenn das Kind Aufmerksamkeit fordert oder wiederholt Grenzen überschreitet geht es selten um Macht, meist um Kontakt und Sicherheit.
Das Kind erlebt: „Wenn ich auffalle, reagierst du. Wenn du mich übersiehst, verliere ich Halt.“
Deine ruhige, aber klare Zuwendung, vielleicht ein Moment echten Augenkontakts oder liebevolle Körpernähe, vermittelt: Ich bin da, du musst mich nicht durch Chaos rufen.
Wenn das Kind wütend wird oder trotzt ist es in diesem Alter eine Überforderungsreaktion, keine gezielte Provokation.
Das Kind kann starke Emotionen noch nicht regulieren und braucht dich als Co-Regulator.
Deine Aufgabe ist nicht, die Wut zu stoppen, sondern sie sicher zu halten. „Ich sehe, dass du dich sehr ärgerst. Ich bleibe bei dir.“ Das zeigt: Gefühle sind erlaubt, Nähe bleibt sicher.
Zwischen dem 4. und 6. Lebensjahr beginnt ein neuer Entwicklungsschritt,
der häufig für Verwirrung sorgt
Das Kind wirkt plötzlich bewusster, manchmal sogar strategisch.
Das liegt an der Reifung des Bewusstseins und sich die Perspektivübernahme (Theory of Mind) entwickelt. Kinder erkennen, dass andere Menschen eigene Gedanken und Informationen haben. Die Fähigkeit Handlungen gedanklich vorauszuplanen entsteht und logisches Denken nimmt zu.
In diesem Alter beginnen Kinder, Möglichkeiten auszuprobieren, nicht um Erwachsene auszuspielen, sondern um Handlungsspielräume zu erforschen.
Wenn Mama Nein sagt und das Kind später Papa fragt, wirkt das wie Manipulation.
Ab dem Vorschulalter taucht mehr Bewusstsein auf.
Eltern kennen die Szene: Die Mutter sagt nein, zehn Minuten später fragt das Kind den Vater.
Gedanke der Eltern: „Aha, jetzt wird manipuliert. Jetzt werden wir gegeneinander ausgespielt.“
Die kindliche Stimme klingt jedoch anders: „Ich habe einen Wunsch. Ich überlege: Wer könnte mir helfen? Ich lerne, wie die Welt funktioniert. Was passiert, wenn ich etwas bei dir nicht bekomme. Bleibst du trotzdem bei mir? Und bleiben Mama und Papa ein Team, das mir Sicherheit gibt?“.
Das ist keine moralische Fehlhaltung, sondern ein normaler Meilenstein der kognitiven Entwicklung.
Hier beginnt Beziehungskompetenz.
Kinder erforschen die Regeln des sozialen Miteinanders.
Sie lernen, welche Reaktionen zuverlässig sind und welche verwirren.
Auch wenn 4- bis 6-Jährige manchmal strategisch handeln, bleibt das Verhalten beziehungsorientiert, niemals kalt berechnend.
Selbst wenn Kinder in diesem Alter taktisch wirken, steckt innerlich kein Machtkampf, sondern ein Gedanke wie: „Ich will Einfluss auf meine Welt haben und ich will trotzdem bei dir bleiben.“
Was Kindern in diesem Alter besonders guttut, ist eine elterliche Haltung, die vermittelt:
- Wir haben klare Regeln und wir als Erwachsene stehen gemeinsam dahinter.
- Du darfst Wünsche haben, aber du bekommst nicht immer alles.
- Du bist gesehen, auch wenn wir nicht deiner Meinung sind.
- Deine Bedürfnisse sind wichtig, und unsere auch.
- Wenn ein Elternteil Nein gesagt hat, bleibt das Nein stabil.
(„Mama hat Nein gesagt und ich bleibe bei ihrem Nein, auch wenn du mich fragst.“) - Eltern oder Bezugspersonen sprechen sich ab. Nicht gegen das Kind, sondern für Klarheit und Sicherheit.
- Wünsche dürfen trotzdem formuliert werden.
Kinder brauchen nicht weniger Wünsche, sondern verlässliche Haltepunkte in der Antwort.
Bei hochsensiblen Kindern ist das innere „Bindungsradar“ deutlich feinfühliger eingestellt
Ihr Nervensystem nimmt Reize intensiver auf, verarbeitet sie langsamer und braucht länger, um sich zu regulieren. Dadurch wirkt ihr Verhalten nach außen oft dramatischer, unberechenbarer oder „fordernder“.
Tatsächlich steckt aber dahinter dasselbe Bedürfnis wie bei allen Kindern: Sicherheit.
Diese Kinder spüren sehr genau, ob ihr Gegenüber authentisch und innerlich präsent ist oder nur eine Rolle spielt.
Für sie ist Beziehung nicht einfach ein Rahmen, sie ist Orientierung, Erdung und Schutz.
Wenn sie keinen echten emotionalen Anker finden, reagieren sie stärker und häufiger, um die fehlende Sicherheit herzustellen.
Darum wirken hochsensible Kinder manchmal so, als würden sie ständig testen.
Doch was wie Machtspiele aussieht, ist in Wahrheit ein besonders intensiver Versuch, sich sicher zu fühlen.
In ihrer inneren Sprache klingt das so:
„Fühlst du mich? Auch, wenn ich laut bin?“
„Bist du wirklich bei mir, oder nur körperlich anwesend?“
„Ist hier alles gut, auch wenn es sich für mich gerade so viel anfühlt?“
Im Säuglingsalter zeigt sich diese Feinfühligkeit oft fast magisch: Sie spüren, wenn Mama oder Papa das Zimmer verlassen, selbst wenn sie gerade eingeschlafen schienen.
In fremder Umgebung wollen sie häufig getragen werden, als wollten sie sagen: „Halte mich fest, bis mein inneres System wieder ruhig wird.“
Sie binden sich tief an wenige vertraute Menschen und brauchen Zeit, um anderen zu vertrauen.
Nichts davon ist Manipulation.
Es ist Bindungsnavigation auf höchster Auflösung.
Und genau diese Kinder profitieren am meisten davon, wenn die Bezugsperson nicht perfekt ist, sondern verlässlich, echt und erreichbar.
Wenn ihre Intensität nicht als Kampf, sondern als Kommunikationsform gelesen wird, entsteht eine Beziehung, die Wachstum für beide möglich macht.
Foto: Privat
Was bleibt, wenn wir Macht und Kontrolle aus der Gleichung nehmen?
Wenn wir „Testen“ als Angriff interpretieren,
gewinnt zwangsläufig irgendwann jemand und jemand verliert.
Doch Kinder brauchen keine Sieger, sondern Orientierung.
Ein Kind muss nicht erleben: „Wenn ich zu weit gehe, bricht die Beziehung weg.“,
sondern:
„Auch wenn es schwierig ist, bleibt jemand an meiner Seite und wir finden einen Weg.“
Kinder testen nicht unsere Autorität. Sie düngen die Beziehung.
Für Kinder bedeutet „Testen“:
„Kann ich dir vertrauen?“
„Hältst du mich, auch wenn ich schwierig bin?“
„Darf ich wachsen, ohne dich zu verlieren?“
Essenziell ist eine Haltung, die Kinder zutiefst stärkt und gleichzeitig die Eltern entlastet:
Nicht „Ich muss mich durchsetzen, um Autorität zu wahren“,
sondern „Ich bin Orientierung und mein Kind darf wachsen, ohne mich zu verlieren.“
Das ist genau der Unterschied zwischen Macht und Führung:
Macht fordert Unterordnung.
Führung schenkt Sicherheit.
„Ich bleibe meinem Kind nah und wir finden uns.“
Nicht immer harmonisch.
Nicht immer ruhig.
Aber zusammen.
Denn letztlich lernen Kinder durch unsere verlässliche Präsenz.
Mit dieser inneren Haltung verändert sich das gesamte Miteinander:
Weniger Kampf, mehr Verbindung.
Weniger Überforderung, mehr Klarheit.
Weniger Druck, mehr Vertrauen auf beiden Seiten.
Und genau dieser Perspektivwechsel
fehlt so vielen Eltern und pädagogischen Fachkräften in der Alltagssprache.
In allen Altersstufen bleibt eines gleich:
Kinder sind niemals gegen uns.
Sie sind für Bindung, Sicherheit, Orientierung und Selbstwerdung.
Und Erwachsene müssen dafür nicht perfekt sein,
nur emotional erreichbar und ehrlich.
Zum Weiterlesen:
- Bindung und menschliche EntwicklungJohn Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie ISBN 978-3-608-94936-0
- Die Bindungstheorie Grundlagen, Forschung und AnwendungGottfried Spangler (Hg.), Peter Zimmermann (Hg.) ISBN: 978-3-608-94628-4
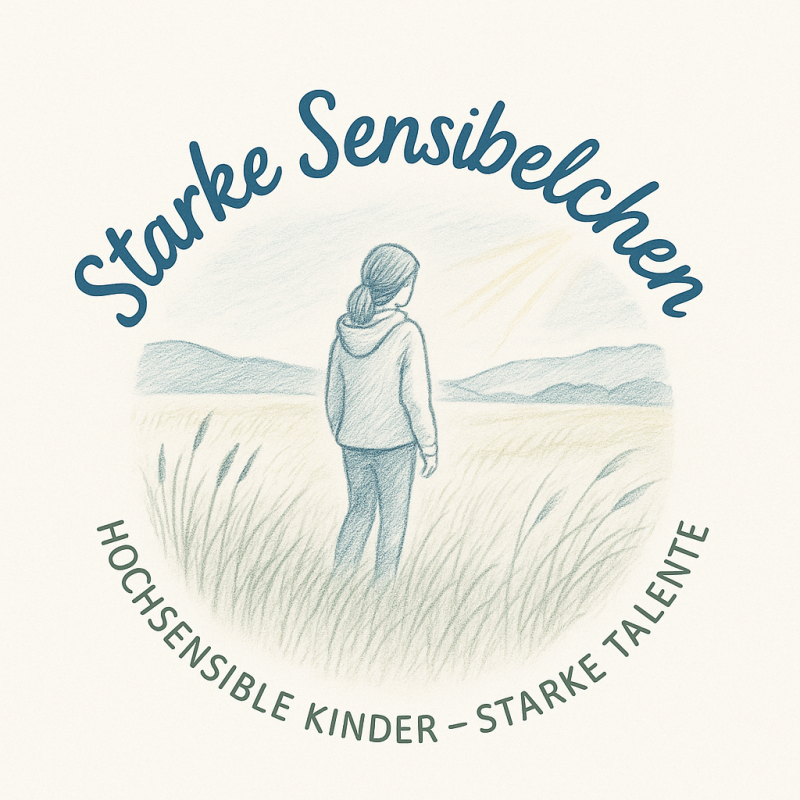



Kommentar hinzufügen
Kommentare