Manchmal scheinen hochsensible Kinder wie zwei Personen in einer zu sein: feinfühlig, aufmerksam, voller Empathie und im nächsten Moment laut, wütend, vielleicht sogar aggressiv. Für Außenstehende wirkt das widersprüchlich.
Doch wer gelernt hat, die Signale dieser Kinder zu "lesen", erkennt: Der Ausbruch ist nicht Böswilligkeit, sondern ein Hilferuf.
Je früher wir die leisen Vorzeichen wahrnehmen, desto besser können wir präventiv handeln und Überforderung vermeiden, zum Wohl des Kindes, der Gruppe und aller Erwachsenen, die mitfühlen und mitleiden.

Foto: Freepik
Wenn alles zu viel wird
Was in hochsensiblen Kindern vorgeht
Hochsensible Kinder nehmen ihre Umgebung intensiver wahr. Geräusche, Gerüche, Berührungen, Stimmungen, all das dringt ungefiltert auf sie ein. Wenn es zu viel wird, gerät ihr Nervensystem in Alarmbereitschaft. Sie erleben Reizüberflutung.
In diesem Moment übernimmt der Körper die Kontrolle: Kampf oder Flucht. Schreien, schlagen oder beißen sind dann keine bewussten Entscheidungen, sondern Übersprungreaktionen. Das Kind kann seine Überforderung nicht anders ausdrücken.
Aggression ist also in diesem Fall kein Zeichen von Bosheit oder schlechter Erziehung, sondern ein Hilferuf des Nervensystems.
Warum Überforderung alle trifft
Das Kind, die Gruppe und uns Erwachsene
Wenn ein Kind so reagiert, trifft es nicht nur das Kind selbst.
Das Kind fühlt sich unverstanden und überwältigt.
Die Gruppe oder Klasse wird plötzlich mit Angst, Irritation oder Störung konfrontiert.
Erzieherinnen und Lehrerinnen müssen reagieren, den Ablauf sichern, und geraten unter Druck.
Eltern fühlen sich oft ratlos, schämen sich oder suchen die Schuld bei sich selbst.
Die Situation ist für niemanden leicht. Aber: Wir sind nicht ohnmächtig - wir sind teilmächtig. (Ruth Cohn)
Das bedeutet: Wir können die Kinder nicht vor allen Reizen der Welt bewahren, aber wir können lernen, sie zu „lesen“ und ihnen beizustehen.
Frühe Signale erkennen
Wie du Kinder lesen lernst
Wenn du genau hinsiehst, zeigen Kinder oft schon früh Anzeichen von Überforderung:
- unruhige Bewegungen, Zappeln
- angespannte Körperhaltung
- schnellere Atmung
- plötzlicher Rückzug oder Gereiztheit
- das Kind wird immer lauter
Wenn du das erkennst, kannst du präventiv reagieren, bevor die Situation eskaliert: das Kind ansprechen, Entlastung anbieten, Alternativen ermöglichen.
Schon ein kurzer Satz wie „Ich sehe, dass es dir zu laut ist“ kann deeskalierend wirken, weil das Kind spürt: Ich werde verstanden.
Missverstanden und abgestempelt
Wie ein Teufelskreis entsteht
Problematisch wird es, wenn sensible Kinder in solchen Situationen immer wieder verurteilt werden, für etwas, das sie in der Überlastung gar nicht willentlich steuern können.
Dauerstress entsteht: Das Kind bleibt in ständiger Alarmbereitschaft, wird immer dünnhäutiger.
Die Ausbrüche häufen sich: Weil die Stressschwelle sinkt, kommt es zu immer häufigeren Übersprungreaktionen.
Eine Rolle verfestigt sich: Das Kind wird als „Problemkind“ gesehen und erlebt sich selbst irgendwann auch so.
Aus diesem Teufelskreis wieder herauszukommen, ist schwer. Umso wichtiger ist es, dass wir Erwachsene den Blickwinkel ändern.
Natürlich haben Kollegen und Koleginnen recht, wenn sie sagen:
"Alle Kinder müssen sich an Regeln halten."
Das stimmt. Doch nicht alle Kinder sind in der Lage, Regeln auf demselben Weg und im selben Tempo einzuhalten.
Manche brauchen Umwege, besondere Methoden oder einfach mehr Zeit.
Wichtig ist: Kein Kind sollte Angst vor einem anderen Kind haben müssen.
Gleichzeitig liegt es an uns Erwachsenen, Wege zu zeigen, wie Kinder ihre Aggressionen, ihre Überforderung und ihre Reizflut so verarbeiten können, dass niemand darunter leidet. Kita und Schule sind schließlich Orte des Lernens, nicht deshalb, weil die Kinder schon alles können, sondern weil sie Schritt für Schritt darin begleitet werden.
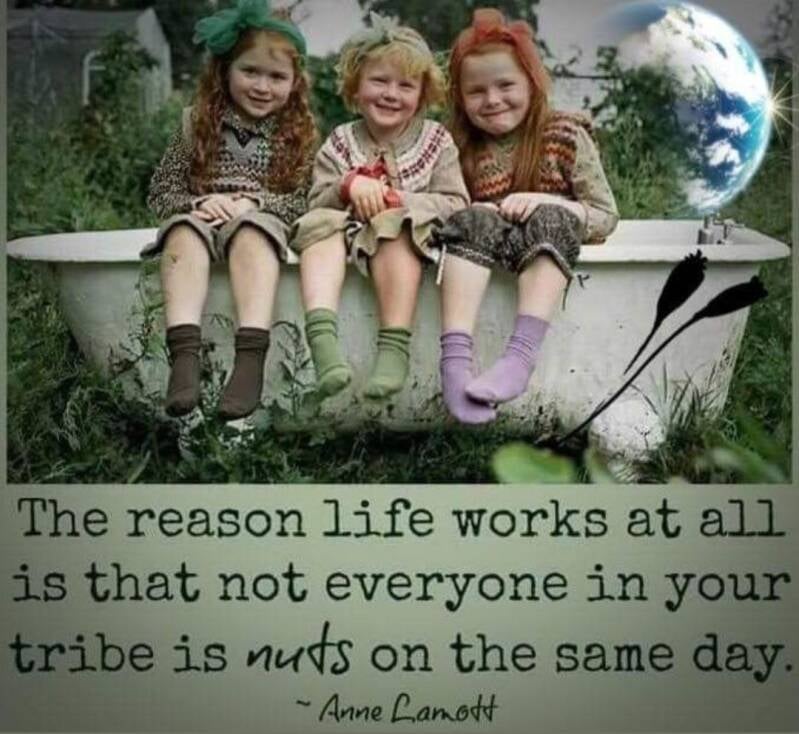
Bild: Pinterest
So kannst du helfen
Konkrete Wege aus der Überlastung
Gefühle spiegeln und benennen
„Ich sehe, dass dich das wütend macht.“
„Es ist dir gerade zu laut, stimmt das?“
So gibst du dem Kind Worte für Gefühle, die es selbst noch nicht ausdrücken kann.
Entlastung ermöglichen
- Rückzugsort schaffen
- kurze Pause an der frischen Luft
- Kompromisse (z. B. ruhige Nische zum Essen statt eine volle Mensa)
Auf Schimpfen verzichten
Schimpfen verstärkt die Überreizung, macht das Kind noch hilfloser und belastet die Beziehung. Ruhe und Klarheit helfen dagegen: „Ich passe auf dich auf. Du darfst wütend sein, aber ich halte deine Hände fest, damit niemand verletzt wird."
Prävention im Alltag
- Rituale und feste Abläufe
- rechtzeitige Ankündigungen von Veränderungen
- kleine Pausen einplanen
- das Kind aktiv nach seinen Bedürfnissen fragen
Auch wir brauchen Hilfe
Warum Unterstützung so wichtig ist
Häufig finden nach wiederholten Vorfällen Elterngespräche statt. Nicht selten schwingen auf beiden Seiten Vorwürfe mit. Eltern fühlen sich angegriffen, Fachkräfte überfordert, oder umgekehrt. Dabei haben alle dasselbe Ziel: dem Kind helfen.
Gerade deshalb ist es so wichtig, dass Eltern und Fachkräfte sich selbst Unterstützung holen, durch Beratung, Fortbildung oder Austausch. Niemand muss solche Situationen allein tragen. Und niemand sollte sich dafür schämen, dass er an seine Grenzen kommt.
Die Kinder brauchen Erwachsene, die nicht perfekt sind, sondern bereit, Strategien zu lernen und auszuprobieren: Gefühle spiegeln, deeskalieren, Rückzug ermöglichen, Beziehung sichern.
Wir Erwachsene dürfen mit den Kindern lernen und wachsen!
Wenn mehr Begleitung nötig ist
Hilfe ohne Stempel
Hochsensibilität ist keine Krankheit. Trotzdem brauchen manche Kinder in belastenden Phasen Hilfe und Unterstützung, unabhängig davon, ob eine offizielle Diagnose vorliegt. Oft ist es hilfreicher, das Kind und seine Lebenswelt ganzheitlich zu betrachten, die Familie, die Gruppe oder Klasse, die Schule oder Kita.
Solch ein Blick eröffnet wertvolle Hinweise: Wo ist das Kind überfordert? Welche Strukturen helfen? Welche Ressourcen können aktiviert werden?
Manchmal ist es sinnvoller, direkt praktische Unterstützung anzubieten, anstatt zuerst lange auf eine Diagnostik zu warten.
Es gibt vielfältige Beratungsstelen wie etwa: Erziehungs-und Lebensberatung, Pädagogische Fachberatung, Schulpsychologischer Dienst, Psychologen oder Psychotherapeuten, spezialisierte Fachberatung, beispielsweise für Autismus, Hochsensibilität, etc..
Ein Ort wie beispielsweise die Oberberg Kliniken kann ein Beispiel dafür sein: Hier gibt es individuelle Programme, die sich an den Bedürfnissen des Kindes orientieren, Entspannungstechniken, Selbstregulation und soziale Kompetenz fördern, ohne dass Sensibilität selbst als Krankheit betrachtet wird.

Foto: Privat
Sensible Kinder sind nicht schwierig
Sie haben es gerade schwierig
Sensible Kinder sind nicht „schwierig“. Sie haben es gerade schwierig.
Hinter ihren Ausbrüchen steckt die gleiche Feinfühligkeit, die sie zu empathischen, kreativen und verantwortungsvollen Menschen macht.
Wenn wir lernen, sie zu lesen, ihnen Worte geben und Entlastung schaffen, profitieren alle: die Kinder selbst, ihre Gruppen und Klassen, die Erwachsenen, die begleiten.
Wir können nicht jede Überreizung verhindern, aber wir können Verständnis, Beziehung und Strategien anbieten. Damit machen wir einen entscheidenden Unterschied und senken den Stresslevel auf lange Sicht.
Weiterlesen & Vertiefen
Fachliche Stimmen zum Thema
Wenn du tiefer einsteigen möchtest, findest du hier einige Fachartikel und Studien zum Thema:
- Lernando: Hochsensible Kinder reagieren auf Reizüberflutung oft mit Aggression oder Rückzug. https://kita-jobs.com/reizueberflutung-bei-kindern/
- AOK: Neurobiologische Grundlagen der Hochsensibilität - warum hochsensible Kinder intensiver wahrnehmen. https://www.aok.de/pk/magazin/familie/eltern/hochsensible-kinder-symptome-und-hilfe-fuer-eltern/
- Oberberg Kliniken: Affektive Dysregulation - wenn Kinder in unkontrollierbare Gefühlsausbrüche geraten. https://www.oberbergkliniken.de/symptome/affektive-dysregulation-im-kindes-und-jugendalter
- Kita-Jobs: Überreizung und Aggression - warum sensible Kinder so reagieren.
- https://kita-jobs.com/die-betreuung-von-hochsensiblen-kindern-in-der-kita/
- Kindergartenpädagogik / Homberg et al. (2017): Neurotransmitter, Gelassenheit und Stressregulation. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27697602/ (englischsprachig)
Kommentar hinzufügen
Kommentare